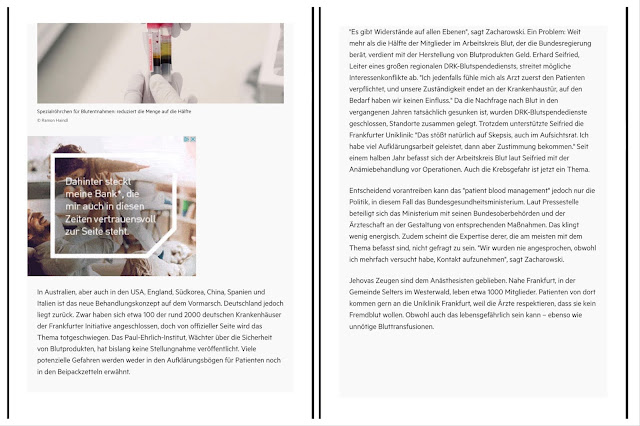Der Patient, der dem Anästhesisten Kai Zacharowski den Glauben an sein Lehrbuchwissen raubte, war Zeuge Jehovas. Dem Mann stand eine große Herzoperation bevor: drei Bypässe und Herzklappenersatz – das Blutungsrisiko war hoch. Er litt zudem unter Blutarmut und würde Fremdblut brauchen. Begleitet wurde er an die Uniklinik Bristol, wo Zacharowski damals arbeitete, von zwei Männern aus dem sogenannten Krankenhausverbindungs-Komitee der Glaubensgemeinschaft. Die Zeugen Jehovas verweigern aus religiösen Gründen die Übertragung von Blut. Zacharowski versprach, was viele Ärzte aus Gewissensgründen ablehnen: Er werde dem Patienten keine Transfusion geben, auch wenn dessen Leben davon abhinge.
Tatsächlich verlor der Patient bei der OP viel Blut, und seine Laborwerte sanken lebensgefährlich tief ab. Doch zu Zacharowskis Erstaunen blieb der Kreislauf stabil, der Mann erholte sich gut. Die gleiche Beobachtung machte der Arzt bei weiteren Zeugen Jehovas.
Fast zehn Jahre liegen diese Erlebnisse zurück. Kai Zacharowski ist mittlerweile Chefanästhesist am Universitätsklinikum Frankfurt und Teil einer weltweit wachsenden Bewegung von Ärzten, die sich dem Blutsparen zum Schutz des Patienten verschrieben hat, dem "patient blood management". "Eine Bluttransfusion", sagt Zacharowski, "ist nichts anderes als eine Mini-Organtransplantation – mit allen Risiken. Nur gehen viele damit sorglos um wie mit einem harmlosen Medikament."
Über einhundert Jahre war die Geschichte der Bluttransfusionen eine Erfolgsstory: Millionen Menschenleben wurden durch sie gerettet, das Spenden galt lange als selbstverständliche Bürgerpflicht. Seine schwerste Vertrauenskrise überstand das System in den 80er Jahren, als sich Tausende Empfänger über verseuchte Konzentrate mit Aids und Hepatitis infizierten. Das waren zu jener Zeit neue Risiken, die inzwischen erfolgreich in Schach gehalten werden. Die Gefahren, von denen Zacharowski spricht, waren jedoch schon immer da, sie wurden nur lange nicht erkannt: Fremdblut zwingt das Immunsystem des Empfängers in die Knie, zu einem Zeitpunkt, an dem er schwach ist – nach Unfällen oder großen Operationen. Es muss sich mit einem neuen "Feind" beschäftigen, anstatt sich der Wundheilung und Krankheitserregern zu widmen. Diese Immunreaktion ist belegt. Zacharowski veröffentlichte 2015 ein Lehrbuch, in dem 48 Studien gelistet sind, die die Daten von mehr als 1,3 Millionen Patienten umfassen. Ein viel diskutiertes Beispiel: Ärzte des Bristol Heart Institute in England entdeckten 2007 an 8500 Herzchirurgie-Patienten, dass von den Fremdblut-Empfängern unter ihnen sechs Mal so viele in den Wochen nach der OP starben. Sie erlitten dreimal so häufig Krankenhausinfektionen, Schlaganfälle, Herzinfarkte oder Nierenversagen. Andere Studien zeigen die gleichen Komplikationen an anderen Patientengruppen – die Häufigkeit variiert, die Aussage bleibt: Fremdblut ist offenbar gefährlich, und das vor allem in den Wochen nach der Übertragung. Daneben scheint es bestimmte Krebsarten zu fördern – dafür sprechen Rattenexperimente und klinische Studien. Am deutlichsten zeigte sich der Zusammenhang bei Darmkrebspatienten, so eine Analyse des Cochrane-Zentrums: Bei Empfängern von Blutkonserven kam es fast eineinhalb mal so häufig zu Rückfällen. Kritiker wenden ein, das seien nur statistische Zusammenhänge, die nicht bewiesen, dass die Bluttransfusionen tatsächlich die Ursache waren. Doch Studien höchster Güte sind aus ethischen Gründen kaum durchführbar – man müsste zwei Patientengruppen bilden und einer von beiden systematisch Bluttransfusionen vorenthalten. Unmöglich – Fremdblut ist immer noch oft unverzichtbar und lebensrettend.
"Patient blood management" soll die Gefahren minimieren. Fünf Jahre brauchten Zacharowski und sein Mitstreiter Patrick Meybohm, um das Behandlungskonzept durchzusetzen. Ein wichtiger Baustein ist dabei die "Anämiesprechstunde". Mitte Januar sitzt dort etwa Paolo D’Urso, dem eine große Bauch-OP bevorsteht, und lässt sich beraten. Seine Blutwerte zeigen eine Eisenmangel-Anämie, die häufigste Form der Blutarmut. Jeder fünfte Mensch weltweit, so Schätzungen, ist betroffen. Einer Studie im Wissenschaftsblatt "Lancet" zufolge haben Anämiepatienten nach Operationen ein 5- bis 13-mal so hohes Risiko zu sterben. Die Weltgesundheitsorganisation fordert deshalb, die Blutarmut vor Eingriffen zu therapieren. Viele, die nicht als Notfall operiert werden müssen, würden profitieren – so wie Paolo D’Urso, der sogleich eine Eisen-Infusion bekommt. "In zwei Wochen sind Ihre Werte normal", sagt die medizinische Fachangestellte Sadaf Arefi-Shamsi.
Weniger Blut, weniger Tote
Im OP-Vorbereitungsraum liegt der 48-jährige Nexhat Krasniqi. Er ist hochnervös. Drei Bypässe soll er bekommen, sein Herz soll stillgelegt und an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen werden. Eine schreckliche Vorstellung für Krasniqi, der unter Panikattacken leidet. Das Blutungsrisiko soll 15 Prozent betragen, vielleicht braucht er Fremdblut – auch das macht ihm Angst. "Man weiß nie, was man sich einfängt." Ein OP-Pfleger nimmt Blut ab. Die Röhrchen sind Spezialanfertigungen, die mit halb so viel Blut auskommen wie das Standardmodell. Der Hersteller hat sie in Zusammenarbeit mit der Uniklinik Frankfurt entwickelt. "Durch die vielen Blutentnahmen im Krankenhaus kommen schnell täglich 50 Milliliter Blutverlust zusammen", erklärt Patrick Meybohm. "Schwer kranke Patienten können so schnell in eine Anämie rutschen. Dieses Risiko vermindern wir." Zwei Stunden später steht Krasniqis Herz still. Neben der Herz-Lungen-Maschine hängt ein weiteres Gerät an seinem Kreislauf, der "Cell Saver". Er fängt das Blut auf, das während der OP verloren geht, und gibt es direkt zurück. "Diese Cell-Saver gibt es in vielen größeren Häusern, nur kostet ihre Bedienung Personal und Zeit. Ein Blutbeutel ist schneller angehängt", sagt Meybohm. Nach fünf Stunden hat Krasniqi den Eingriff ohne Fremdblut überstanden.
Anämie-Diagnostik, Mini-Blutröhrchen, Eigenblut-Transfusion im OP – das sind nur drei von mehr als 100 Einzelmaßnahmen des "patient blood management".
Die Uniklinik Frankfurt nimmt heute international eine Vorreiterrolle ein. "Wir sparen bis zu 40 Prozent an Blutkonserven ein, ohne dass die Patientensicherheit leidet", sagt Zacharowski. Den Nachweis erbrachte er vergangenes Jahr mit den Unikliniken Bonn, Kiel und Münster in einer gemeinsamen Studie an 130.000 Patienten. Ein Ergebnis: In den drei Jahren nach der Einführung von "patient blood management" sank die Zahl der Patienten mit akutem Nierenversagen um ein Drittel. Vor wenigen Tagen erschien eine weitere Studie an 605.000 Patienten in Westaustralien. Seit die Ärzte dort Blut sparen, sanken in vier großen Kliniken die Sterblichkeit sowie die Häufigkeit von Schlaganfällen und Herzinfarkten ebenfalls jeweils um ein Drittel. Co-Autor Axel Hofmann, ein Züricher Gesundheitsökonom, glaubt: "Unsere Ergebnisse werden ein mittleres Erdbeben auslösen."
In Australien, aber auch in den USA, England, Südkorea, China, Spanien und Italien ist das neue Behandlungskonzept auf dem Vormarsch. Deutschland jedoch liegt zurück. Zwar haben sich etwa 100 der rund 2000 deutschen Krankenhäuser der Frankfurter Initiative angeschlossen, doch von offizieller Seite wird das Thema totgeschwiegen. Das Paul-Ehrlich-Institut, Wächter über die Sicherheit von Blutprodukten, hat bislang keine Stellungnahme veröffentlicht. Viele potenzielle Gefahren werden weder in den Aufklärungsbögen für Patienten noch in den Beipackzetteln erwähnt.
"Es gibt Widerstände auf allen Ebenen", sagt Zacharowski. Ein Problem: Weit mehr als die Hälfte der Mitglieder im Arbeitskreis Blut, der die Bundesregierung berät, verdient mit der Herstellung von Blutprodukten Geld. Erhard Seifried, Leiter eines großen regionalen DRK-Blutspendediensts, streitet mögliche Interessenkonflikte ab. "Ich jedenfalls fühle mich als Arzt zuerst den Patienten verpflichtet, und unsere Zuständigkeit endet an der Krankenhaustür, auf den Bedarf haben wir keinen Einfluss." Da die Nachfrage nach Blut in den vergangenen Jahren tatsächlich gesunken ist, wurden DRK-Blutspendedienste geschlossen, Standorte zusammen gelegt. Trotzdem unterstützte Seifried die Frankfurter Uniklinik: "Das stößt natürlich auf Skepsis, auch im Aufsichtsrat. Ich habe viel Aufklärungsarbeit geleistet, dann aber Zustimmung bekommen." Seit einem halben Jahr befasst sich der Arbeitskreis Blut laut Seifried mit der Anämiebehandlung vor Operationen. Auch die Krebsgefahr ist jetzt ein Thema.
Entscheidend vorantreiben kann das "patient blood management" jedoch nur die Politik, in diesem Fall das Bundesgesundheitsministerium. Laut Pressestelle beteiligt sich das Ministerium mit seinen Bundesoberbehörden und der Ärzteschaft an der Gestaltung von entsprechenden Maßnahmen. Das klingt wenig energisch. Zudem scheint die Expertise derer, die am meisten mit dem Thema befasst sind, nicht gefragt zu sein. "Wir wurden nie angesprochen, obwohl ich mehrfach versucht habe, Kontakt aufzunehmen", sagt Zacharowski.
Jehovas Zeugen sind dem Anästhesisten geblieben. Nahe Frankfurt, in der Gemeinde Selters im Westerwald, leben etwa 1000 Mitglieder. Patienten von dort kommen gern an die Uniklinik Frankfurt, weil die Ärzte respektieren, dass sie kein Fremdblut wollen. Obwohl auch das lebensgefährlich sein kann – ebenso wie unnötige Bluttransfusionen.